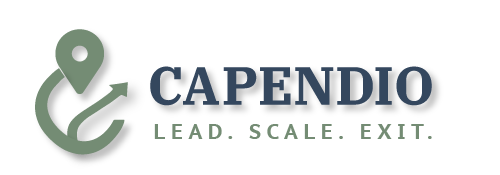Vom rasantem Wachstum zu nachhaltigem Erfolg
Mit dem folgenden Beitrag möchte ich Euch meine Erfahrungen zur Entwicklung einer modernisierten Denkweise zur Strategieumsetzung innerhalb der has·to·be gmbh erläutern, die wir 2021 im größten Exit an eine US Company verkauft haben.
Als langjähriger Geschäftsführer eines dynamisch wachsenden Softwareunternehmens, der has·to·be gmbh, stand ich häufig vor der Herausforderung, meinem Team die Unternehmensstrategie so zu vermitteln, dass alle an einem Strang ziehen. Das, was acht Jahre später als der bis dahin größte Startup-Exit in der österreichischen Startup-Szene bekannt werden sollte – die Veräußerung der has·to·be gmbh im Jahr 2021 für 250 Millionen Euro – begann im Oktober 2013 mit einer gemeinsamen Vision: CO₂-neutrale Mobilität zugänglich zu machen.
Wir starteten in einem Markt, der faktisch noch nicht existierte: dem Aufbau von Ladeinfrastruktur für elektrisch betriebene Fahrzeuge. Anfangs wollten wir ein langsam wachsendes, nachhaltig profitables Unternehmen aufbauen, doch der dynamisch wachsende Markt stellte unsere Planung auf den Kopf. Innerhalb kurzer Zeit skalierten wir auf rund 180 Mitarbeitende und wurden europäischer Marktführer. Diese rasante Entwicklung zeigte uns exemplarisch, dass die permanente Anpassung von Ausrichtung und Umsetzungslogik essenziell für langfristigen Erfolg ist.
Der „Eisberg“ im Unternehmen: Als die persönliche Führung an ihre Grenzen stieß
In den ersten zwei Jahren verlief die Entwicklung bei has·to·be noch strukturiert. Neue Mitarbeitende wurden sukzessive integriert und aktiv in unsere Unternehmenskultur eingeführt. Die Teamgröße ermöglichte noch eine direkte, persönliche Einarbeitung. Doch ab einer Größe von rund 30 Personen traten erste Herausforderungen auf: Neue Kolleg:innen fanden schwerer Zugang zur offenen, dynamischen Kultur, und unsere Vision und langfristigen Ziele wurden zunehmend weniger klar verstanden.
Obwohl wir regelmäßig über Strategie und Werte kommunizierten, stieß die „persönliche Führung“ an ihre Grenzen. Informelles Wissensmanagement verlor seine Wirkung, und es entstand ein Zustand von Unübersichtlichkeit: Mitarbeitende handelten nach bestem Wissen, doch es fehlte an Struktur und gemeinsamer Richtung. Die Folge: Ineffizienz, Reibungsverluste und finanzielle Belastung. Weder regelmäßige All-Company-Meetings noch andere spontane Maßnahmen konnten diesen Trend aufhalten.
Wir nannten dieses Phänomen den „Eisberg“ im Unternehmen: Oberflächlich mag alles in Ordnung erscheinen – die Prozesse laufen, Meetings finden statt, Ziele werden irgendwie erreicht. Doch unter der Oberfläche breiteten sich Frustration, Rückzug, innere Kündigung und Sinnverlust bereits aus. Mitarbeitende konnten ihr Potenzial nicht ausschöpfen, weil organisatorische Blockaden, unklare Verantwortlichkeiten und mangelnde Entscheidungsspielräume sie einschränkten.
OKR: Eine vielversprechende Methode, die an unseren Bedürfnissen scheiterte
Da eine straffe Top-down-Führung unserem Verständnis von einem gemeinschaftlich gestalteten Unternehmen widersprach, suchten wir nach Alternativen. Wir wandten uns modernen Managementsystemen zu, etwa der Führung mit Zielen auf Basis von „Objectives and Key Results“ (OKR). Diese Methode brachte anfangs klare Verbesserungen: Mitarbeitende begannen, eigenständig Ziele zu formulieren und Entscheidungen zu treffen. Der Grad an Selbstverantwortung stieg, und die Messung der Zielerreichung erfolgte über definierte Key Performance Indicators (KPIs).
Doch nach rund einem halben Jahr zeigten sich erste deutliche Effekte, die sich bei genauerer Betrachtung als strategischer Zielkonflikt entpuppten: Viele der getroffenen Entscheidungen unterschieden sich nicht nur von den Vorstellungen des Managements, sie standen in direktem Widerspruch zu unserer strategischen Ausrichtung. Die Entscheidungen entsprachen der Logik der gesetzten Metriken, jedoch nicht dem, was wir als Führungsteam unter „richtige Richtung“ verstanden.
Rückblickend identifizierten wir folgende zentrale Probleme, die zum Scheitern von OKR bei uns führten:
- Fehlende abteilungsübergreifende Informationen: Mitarbeitende konnten keine fundierten Entscheidungen treffen, da ihnen wichtige Erkenntnisse fehlten, was die Effektivität negativ beeinflusste. Dies führte dazu, dass individuelle Ziele priorisiert wurden, während die Unternehmensstrategie in den Hintergrund trat.
- Schwierigkeit, in Zielen zu denken: Für viele Teammitglieder war es ungewohnt und teils überfordernd, strategische Leitlinien in konkrete, messbare Objectives und Key Results zu übersetzen.
- Asymmetrie in der Co-Creation: Obwohl die Zielentwicklung gemeinsam im Team erfolgen sollte, wurde die Zieldefinition in der Praxis oft von Führungskräften oder wenigen High Potentials geprägt. Dies erzeugte ein Spannungsfeld zwischen dem Anspruch an Selbstorganisation und der faktischen Umsetzung von Top-down-Vorgaben.
- Unterschiedliche Wahrnehmungen: Ein zentrales Problem war, dass unterschiedliche Wahrnehmungen zwischen Führung und Team nicht explizit gemacht wurden. Es fehlte an einem gemeinsamen Fundament, auf dem Ziele glaubwürdig aufbauen konnten.
- Fokus auf Quantität statt strategischer Qualität: Das OKR-System belohnte die Erfüllung von Key Results, unabhängig davon, ob der gewählte Lösungsweg tatsächlich zur strategischen Zielsetzung beitrug. Beispielsweise konnten automatisierte Antworten im Support zwar die Antwortzeit statistisch senken, aber die Kundenzufriedenheit nicht wirklich verbessern.
- Ressourcenbegrenzung im Startup: Als Startup verfügten wir nicht über die nötigen Ressourcen, um ineffiziente Abweichungen vom strategischen Kern zu finanzieren. Wir brauchten eine zielgerichtete Umsetzung ohne Reibungsverluste.
- Komplexität der Formulierung: Das Formulieren von Objectives und Key Results war grundsätzlich komplex und ließ großen Interpretationsspielraum zu, was zu zeitintensiven Diskussionen über sprachliche Details statt über strategische Ausrichtung führte.
Wir beendeten die Steuerung über OKR nach rund 16 Monaten, da wir erkannten, dass die Führung von Mitarbeitenden auf Basis von KPIs allein nicht geeignet ist, eine Unternehmensstrategie effizient und wirkungsvoll umzusetzen. Was uns fehlte, war ein kollektives, tragfähiges Verständnis über die Grundlage unseres unternehmerischen Handelns sowie der Rahmenbedingungen unseres Umfeldes – die sogenannte „Shared Reality“.
Die Geburt der Art-of-Acceleration (AOA) Methodologie
Diese Erfahrungen aus der rasanten Skalierung der has·to·be gmbh bildeten die Grundlage für die Entwicklung der Art-of-Acceleration (AOA) Methodologie. Da wir trotz intensiver Recherchen keine passende Lösung fanden, entschieden wir uns, einen eigenen Ansatz zu entwickeln. AOA wurde nicht nur zu einem Managementansatz, sondern zum entscheidenden Katalysator für unser Wachstum und machte die Skalierung in dieser Form überhaupt erst möglich.
AOA ist ein menschenzentrierter Managementansatz, der die Lücke zwischen Strategie und operativer Umsetzung wirksam schließt. Unser Ziel war es, die Verantwortung dort zu verankern, wo die Wirkung entsteht: im täglichen Handeln der Teams.
Hier ein kurzer Überblick über die Entstehung und die Vorteile der AOA-Methodologie (englisch):
Die AOA-Methodologie basiert auf drei zentralen Kernbestandteilen, die die bei uns erlebten Herausforderungen adressieren:
- Shared Reality: Dieser Baustein schafft ein gemeinsames, umfassendes und objektives Verständnis der aktuellen Situation. Er zwingt Organisationen dazu, verborgene Divergenzen in der Wahrnehmung offenzulegen. Dies umfasst den Status Quo, identifizierte Herausforderungen (Challenges), zugrundeliegende Annahmen (Beliefs), strategische Abgrenzungen (Boundaries) und bereitgestellte Ressourcen (Input).
- Strategic Direction: Basierend auf der Shared Reality werden hier die übergeordneten, langfristigen Ziele („Higher Intents“) und die konkreten Zielsetzungen für die aktuelle Planungsiteration („Intents“) formuliert.
- Execution Management: Dieser Bereich umfasst alle Methoden und Formate, die die Zusammenarbeit auf operativer Ebene systematisch fördern. Die konkrete Planung der Aktivitäten („Actions“) erfolgt in einem Co-Creation-Ansatz in den jeweiligen operativen Teams.
Die konsequente Anwendung von AOA führte bei uns zu messbaren Erfolgen:
- Steigende Zufriedenheit der Belegschaft
- Signifikante Verbesserung des Umsatz-Kosten-Verhältnisses
- Kürzere und zuverlässigere Innovationszyklen
- Erhöhtes Maß an Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Leistungsbereitschaft
- Gestärkte Teamfähigkeit und Zusammenarbeit
- Erhöhte operative Schlagkraft bei gleichzeitiger strategischer Zielorientierung
- Die has·to·be gmbh wurde 2021 für 250 Millionen Euro verkauft – der zu diesem Zeitpunkt größte bekannte Startup-Exit in Österreich.
Die Art of Acceleration hat uns als entscheidender Katalysator für unser Wachstum gedient. Sie hat uns nicht nur in der Skalierung unterstützt, sondern sie in dieser Form überhaupt erst möglich gemacht. Unsere Erfahrungen zeigten, dass diese Arbeitsweise in unterschiedlichsten Kontexten erfolgreich übertragen werden konnte, und deshalb haben wir sie als AOA-Methodologie systematisch beschrieben, um auch anderen Organisationen zu helfen, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und langfristigen Erfolg zu sichern. AOA ist nicht nur ein Steuerungsinstrument, sondern ein Katalysator für Wachstum, der den Menschen in den Mittelpunkt der Strategieumsetzung rückt.